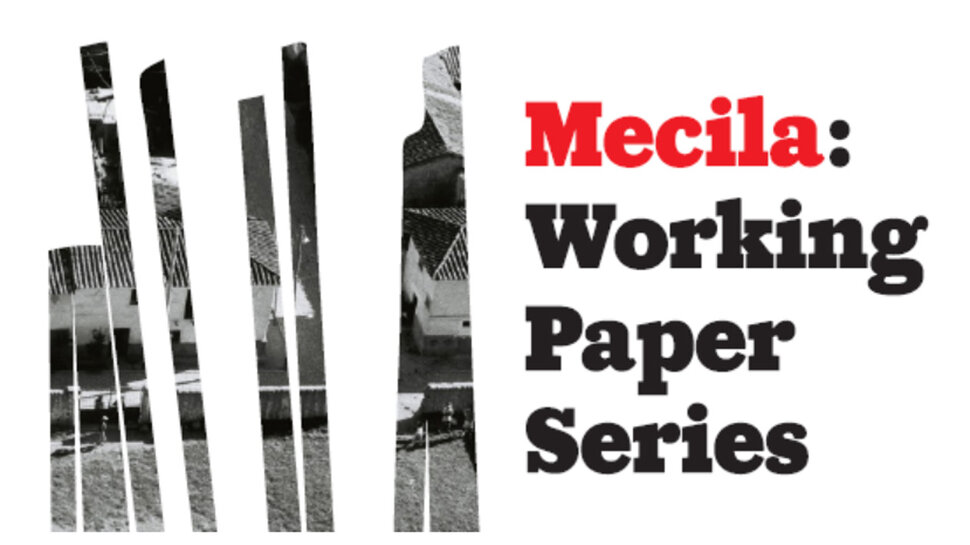Das Ibero-Amerikanische Institut (IAI) ist eine der Institutionen, die in dem internationalen Verbundprojekt Mecila (Maria Sibylla Merian Centre Conviviality-Inequality in Latin America) (externer Link, öffnet neues Fenster)mitarbeiten. Mecila untersucht soziale, politische und kulturelle Formen des Zusammenlebens und der Ungleichheit in Lateinamerika und der Karibik aus interdisziplinärer Perspektive. Die Forschungsergebnisse des Verbundes werden in unterschiedlichen Formaten veröffentlicht, unter anderem in einer umfassenden Reihe von Working Papers. In dem Mecila Working Paper „Restitution and Postcolonial Justice“ (Working Paper No. 84, 2025) widmet sich Julia von Sigsfeld einem zentralen Anliegen postkolonialer Kulturdiskurse: der Restitution von Kulturgütern aus europäischen Museen und Sammlungen an ihre Herkunftsgesellschaften. Dabei geht von Sigsfeld über rein juristische oder administrative Diskussionen hinaus und entwickelt ausgehend von einem dialogischen Ansatz Perspektiven für Gerechtigkeit jenseits kolonialer Machtstrukturen. Im Mittelpunkt ihrer Überlegungen steht die Frage, wie Restitutionsprozesse in unterschiedlichen Kontexten motiviert und gestaltet werden und welche Rolle dabei ethische Reflexion, internationale Kooperation und transkultureller Austausch spielen. Von Sigsfeld zeigt, dass Rückgabeforderungen meist auf einer Mischung rechtlicher Ansprüche, moralischer Argumente und politischer Verhandlungen beruhen. Sie unterstreicht, dass erfolgreiches Handeln nur möglich ist, wenn Herkunftsgesellschaften und involvierte Institutionen auf Augenhöhe miteinander sprechen und Lösungen gemeinsam entwickeln.
Zentral ist für die Autorin das Postulat eines echten Dialogs: Restitution darf nicht als einseitiger, von europäischen Akteuren dominierter Prozess verstanden werden, sondern muss ein kooperatives Geschehen sein, in dem verschiedene Wissenssysteme und ethische Vorstellungen gleichberechtigt Platz finden. Museen, politische Entscheidungsträger und Vertreter*innen der Herkunftsgesellschaften sollen gemeinsam Verfahren entwickeln, in denen nicht nur materielle Eigentumstitel, sondern auch symbolische Anerkennung und die Heilung historischer Traumata zählen.
Das Working Paper betont, dass Restitution nicht als einmaliger Akt gesehen werden darf, sondern Teil eines umfassenden Gerechtigkeitsprozesses sein muss. Dazu gehören Transparenz, gegenseitiger Respekt und die Bereitschaft, gemeinsam historische Narrative neu zu bewerten. Auch die Reflexion von Machtasymmetrien ist wichtig: Selbst in scheinbar partnerschaftlichen Gesprächen bleibt das koloniale Erbe oft spürbar, sei es durch Ressourcenunterschiede, unterschiedliche Wissensformen oder asymmetrische Beteiligungschancen. Die Autorin ruft dazu auf, diese Machtverhältnisse nicht zu verschweigen, sondern offensiv anzugehen. Nur so – so ihr Fazit – kann Restitution tatsächlich als Beitrag zu postkolonialer Gerechtigkeit verstanden werden.